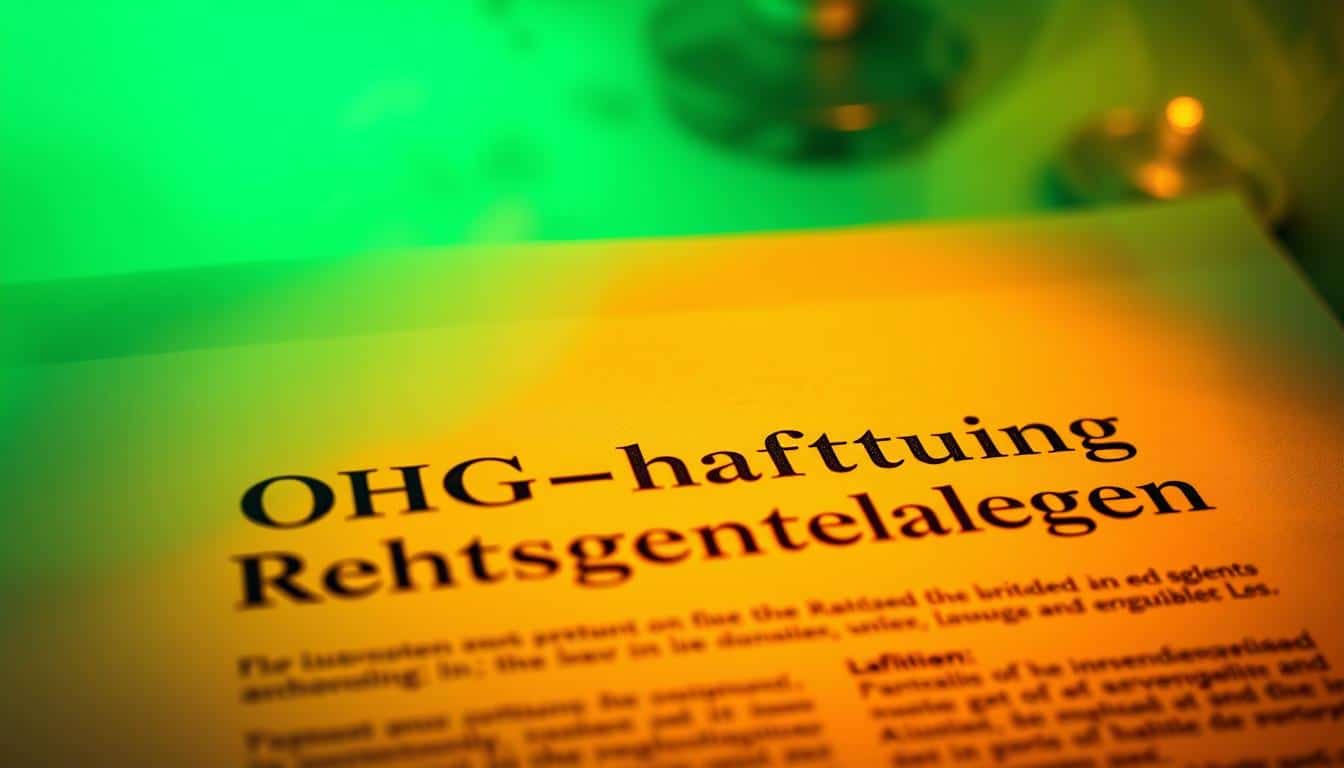Im Jahr 2025 steigen Anfragen nach steuerfreien, gemeinnützigen Strukturen um 34 Prozent – und die gGmbH ist das zentrale Werkzeug dafür. Als Autor der Unternehmer-Innovation.de analysiere ich hier die modernste Rechtsform für soziales Engagement und wirtschaftliche Professionalität.
Dr. Maximilian Berger, Experte für gemeinnützige Unternehmen, erklärt: „Die gGmbH vereint 2025 steuerliche Vorteile mit einer GmbH-Struktur. Jedes Jahr mehr als 15.000 Organisationen wechseln auf diese Form, um Spenden zu erhöhen oder Projekte zu skalieren.“
Die gGmbH 2025 ermöglicht es, Gewinne nicht an Gründer auszuzahlen, sondern für Wissenschaft, Naturschutz oder Bildung zu verwenden. Damit entsteht eine Rechtsform, die sowohl soziales Handeln wie auch wirtschaftliche Effizienz fördert.
Warum? Weil die gGmbH Rechtsform 2025 vorgeschrieben Voraussetzungen bietet: Vollständige Gewerbesteuerbefreiung, Flexibilität bei Gründung und eine klare Regulierung durch § 51 AO. Diese Faktoren machen die gemeinnützige GmbH zu einem Innovationsmotor für 2025.
Was ist eine gGmbH? Definition und Grundlagen
Die gemeinnützige GmbH (gGmbH) ist eine Rechtsform, die soziale und wohltätige Ziele mit Unternehmensstruktur verbindet. Sie ermöglicht gemeinnützigen Organisationen steuerliche Vorteile, während sie wie eine klassische GmbH organisiert arbeitet. Die gGmbH Grundlagen regeln die Anforderungen an Satzung, Finanzierung und Zweckbindung.
Rechtliche Einordnung der gGmbH im deutschen Gesellschaftsrecht
Im gGmbH-Gesetz (GmbHG) werden die Anforderungen definiert: Die Satzung muss einzig oder primär gemeinnützige Zwecke verfolgen. Die gemeinnützige GmbH muss vom Finanzamt als solche anerkannt werden. Steuerlich entfallen Körperschafts- und Gewerbesteuer, Umsatzsteuer freistehend bis 45.000 € Umsatz.
Unterschied zwischen GmbH und gGmbH
- Zweck: Die gGmbH verfolgt gemeinnützige Ziele, während die GmbH Gewinnerzielung hat.
- Stammeinlage: 25.000 € für gGmbH vs. 25.000 € für GmbH.
- Steuer: gGmbH genießt Steuervorteile, GmbH ist steuerpflichtig wie normale Unternehmen.
- Vermögensnutzung: Gewinne dürfen nicht an Anteilseigner verteilt werden, sondern in Zwecke investiert.
Historische Entwicklung der gGmbH in Deutschland
Seit der Einführung 2002 durch das GmbHG hat die gGmbH Bedeutung gewonnen. 2025 betreffen neue steuerliche Regelungen, wie die Anpassung der Umsatzfreigrenze auf 45.000 €. Aktuelle Vorgaben des Finanzamts betonen eine strikte Zweckbindung, um Missbrauch zu verhindern.
Die gGmbH Rechtsform: Besonderheiten und Charakteristika
Die gGmbH Rechtsform verbindet gemeinnützige Ziele mit geschäftlicher Struktur. Ein zentrales Merkmal ist die Beschränkung der Gewinnverwendung: Überschüsse dürfen nur für die Satzungszwecke verwendet werden. gGmbH Charakteristika spiegelt die Rechtsvorgaben der Gemeinnützigkeit.
- Mindeststammkapital von 25.000 €, davon 12.500 € als Bareinzug
- Steuerfreie Status wenn Satzung und Tätigkeit §52 AO entsprechen
- Keine Gewinne an Gesellschafter, lediglich an gemeinnützige Ziele
| Aspekt | gGmbH | GmbH | Verein |
|---|---|---|---|
| Kapital | 25.000 € (mindestens 12.500 € Bar) | 25.000 € (frei vertraglich) | Keine Kapitalvorgaben |
| Umsatzsteuer | 7% bei Zweckbetrieben | 19% Standard | Keine USt. für gemeinnützige Tätigkeiten |
| Gewinne | Nur für gemeinnützige Zwecke | Kann an Anteilseigner verteilt werden | Keine Gewinnerwartung |
Die gGmbH Merkmale umfassen auch die Satzungspräzision: Der Unternehmensgegenstand muss in der Satzung klar definiert sein. Ab 501 Mitarbeitern ist ein Aufsichtsrat obligatorisch. Eine Besonderheit: Überschüssiges Vermögen kann nur an andere gemeinnützige Organisationen überführt werden. Diese gGmbH Charakteristika machen die Rechtsform 2025 attraktiv für soziale Unternehmer.
Vorteile der gGmbH als Unternehmensform in 2025
Die gGmbH bietet in 2025 klare Vorteile für Initiativen, die gemeinnützige Ziele verfolgen. Diese Rechtsform vereint steuerliche Anreize mit gesetzlicher Sicherheit, um soziale und ökologische Projekte effektiv umzusetzen.
Steuervorteile gGmbH
Die Steuervorteile gGmbH machen die Form attraktiv. Gemeinnützige Leistungen wie Bildung oder Klimaschutz entfallen vollständig von Umsatzsteuer. Umsätze über 45.000 Euro jährlich unterliegen regulärer Besteuerung, jedoch bleiben Körperschafts- und Gewerbesteuer bis 2025 befreit. Spender erhalten steuerliche Abschöpfungen über Spendenbescheinigungen, was Spendenattraktivität steigert.
gGmbH Haftung und Kapitalschutz
Die gGmbH Haftung ist auf das Stammkapital begrenzt. Mit 25.000 Euro Mindestkapital schützt das Gesetz private Vermögen der Gesellschafter. Einwandfreie Trennung des Firmen- und Privatvermögens ist Pflicht, um Strafen zu vermeiden.
Möglichkeiten der Gewinnverwendung
Gewinne dürfen nicht an Anteilseigner verteilt werden. Stattdessen können sie für folgende Zwecke eingesetzt werden:
- Rücklagen für zukünftige Projekte
- Erweiterung gemeinnütziger Dienstleistungen
- Modernisierung von Infrastruktur
Gesellschaftliches Ansehen
„Die gGmbH symbolisiert Verantwortung und Langzeitplanung.“ – Bundesministerium der Justiz 2025
Unternehmen profitieren durch das Markenprofil der gGmbH: Kunden bevorzugen soziale Marken. Das Rechtszeichen „gGmbH“ signalisiert Transparenz gegenüber Spendern und Partnern.
Die Kombination von Steuervorteilen, Haftungsschutz und gesellschaftlichem Prestige macht die gGmbH 2025 zu einem maßgeblichen Mittel für nachhaltige Wirtschaftsmodelle.
Gemeinnützigkeit: Voraussetzungen und Anforderungen 2025
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit Voraussetzungen 2025 basiert auf klaren Regeln der Abgabenordnung gGmbH. Jede gGmbH muss drei Prinzipien einhalten: Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit. Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, entstehen steuerliche Vorteile.
Die gemeinnützige Zwecke müssen in der Satzung festgelegt sein. Erlaubt sind Tätigkeiten wie Bildung, Kultur, Soziale Fürsorge oder Umweltschutz. Die Abgabenordnung gGmbH listen folgende Bereiche auf:
- Soziale Hilfsmaßnahmen
- Wissenschaftliche Forschung
- Kulturelle Projekte öffentlichen Nutzen
Gerichtsentscheide 2024/2025 klären aktuelle Unklarheiten. So entschied das Finanzamt, dass Einkünfte aus Nebengeschäften steuerpflichtig sind, wenn diese den hauptlichen gemeinnützige Zwecke nicht unmittelbar unterstützen.
Zentrales Kriterium ist die Unmittelbarkeit: Die Tätigkeiten dürfen nicht durch Dritte übertragen werden. Zudem muss das gesamte Vermögen ständig für gemeinnützige Ziele eingesetzt werden. Die Abgabenordnung gGmbH verbietet Gewinne an Anteilseigner, da die Selbstlosigkeit Voraussetzung ist.
| Kriterium | Beispiel |
|---|---|
| Ausschließlichkeit | Keine Nebengeschäfte, die nicht dem gemeinnützigen Zweck dienen |
| Selbstlosigkeit | Keine Gewinnerwartung für Anteilseigner |
| Unmittelbarkeit | Projekte werden selbst durchgeführt, nicht subventioniert |
Gründung einer gGmbH: Schritt-für-Schritt-Anleitung für 2025
Die gGmbH gründen erfordert eine klare Vorgehensweise. Folgen Sie diesen 10 Schritten zur gGmbH Gründung 2025, um alle rechtlichen Anforderungen zu erfüllen:
- Geschäftsidee entwickeln: Legen Sie einen gemeinnützigen Zweck fest, z. B. Bildung oder Umweltschutz.
- Businessplan erstellen: Dokumentieren Sie wirtschaftliche Tragfähigkeit und soziale Ziele.
- Gesellschaftsvertrag aufsetzen: Mit einem Notar beurkunden und die Gemeinnützigkeit präzise definieren.
- Stammkapital einsetzen: Mindestens 25.000 €, davon 12.500 € sofort einziehen.
- Geschäftskonto eröffnen: Wähle ein Konto mit geringem monatlichen Aufwand (0–250 €).
- Handelsregistermeldung: Der Notar leitet die Unterlagen ein, sobald die Satzung genehmigt ist.
- Gewerbeanmeldung: Kosten: 20–60 €, Dauer: bis 2 Werkstage.
- Steuerliche Erfassung: Beantragen Sie die Körperschaftsteuerbefreiung (max. 45.000 € jährliche Gewinne).
- IHK/HWK-Mitgliedschaft: Kosten: 50–200 €, obligatorisch für Gewerbetreibende.
- Betriebsnummer beantragen: Nach Abschluss der Registrierungen innerhalb von 7 Tagen.
Die gGmbH Gründung Schritte erfordern präzise Planung. Achtung: Das Finanzamt prüft streng die Gemeinnützigkeit. Haftung ist auf das Firmenvermögen begrenzt, Privatvermögen bleibt geschützt. Für den Gesellschaftervertrag empfiehlt sich professionelle Unterstützung, da Formfehler teuer enden können. Die Gesamtlaufzeit der gGmbH Gründung 2025 beträgt etwa 3–4 Wochen, je nach Behördengeschwindigkeit.
„Die Erstellung der Satzung ist entscheidend – hier muss der gemeinnützige Zweck unmissverständlich formuliert werden.“ – Bundesfinanzamt, 2024
Zusätzlich zu den gGmbH Gründung Schritten: Überprüfen Sie Steuervorteile wie die Umsatzsteuerermäßigung auf 7 % und die Spendenabzüge. Beachten Sie, dass Gewinne nur für den gemeinnützigen Zweck verwendet werden dürfen. Starten Sie frühzeitig mit der Notarisierung, da dieser Schritt bis zu 3 Stunden in Anspruch nehmen kann.
Stammkapital und Finanzierung der gGmbH
Die Planung des gGmbH Stammkapitals und die Auswahl der richtigen Finanzierungsmethoden bilden den Grundstock für den Erfolg einer gemeinnützigen GmbH. Die 2025 gültigen Vorschriften legen klare Regeln für die Kapitalierung und die Diversifizierung von Finanzierungsquellen fest.
„Die gGmbH Finanzierung erfordert eine Kombination aus traditionellen und innovativen Strategien, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.“
Mindestkapitalanforderungen und Einlagen
Zur Gründung ist ein Mindeststammkapital von 25.000 € vorgeschrieben. Mindestens 12.500 € müssen unverzüglich eingezahlt werden. Sacheinlagen sind zulässig, müssen aber durch Experten begutachtet werden. Diese Vorgaben sichern die finanzielle Transparenz und das Überleben im Startphase.
Finanzierungsquellen für gemeinnützige Unternehmen
Vielfältige Optionen stehen zur Verfügung:
- Spenden und Spendenbescheinigungen
- Bundes- und EU-Fördermittel
- Unternehmenssponsoring mit markenstrategischen Vorteilen
- Sozialanleihen mit langfristigen Tilgungsbedingungen
- Abnehmerbeiträge für Dienstleistungen
Moderne Finanzierungsinstrumente für gGmbHs in 2025
Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten:
- Impact Investing: Investoren unterstützen soziale Projekte mit langfristigem Rückfluss
- Crowdfunding-Plattformen wie Startnext oder Betterplace für Projektfinanzierung
- Hybride Modelle, die Stiftungsgelder mit private Investments kombinieren
Die Kombination traditioneller und digitaler Kanäle ermöglicht eine nachhaltige Finanzierung der gemeinnützigen Missionen. Die richtige Planung der gGmbH Finanzierung gewährleistet langfristige Stabilität und Wachstumspotenzial.
Satzungsgestaltung für eine erfolgreiche gGmbH
Die gGmbH Satzung bildet das Fundament für die Rechts- und Finanzierungssicherheit des Unternehmens. Jede Gesellschaftsvertrag gGmbH muss den § 1-4 GmbHG und die Steuervorschriften der Abgabenordnung erfüllen. Die gGmbH Satzungsgestaltung 2025 muss folgende Kernpunkte enthalten:
| Pflichtbestandteile | Wichtigste Regelungen |
|---|---|
| Bezeichnung „gGmbH“ | Präzise Beschreibung des gemeinnützigen Zwecks gemäß §52 AO |
| Mindeststammkapital von 25.000 € | Verpflichtung zur Vermögensbindung und Zweckbindung |
| Angabe des Sitzes | Definition der Geschäftsführungsrechte und -pflichten |
Ein korrekt abgefasster Gesellschaftsvertrag gGmbH muss die Gewinnverwendung auf den gemeinnützigen Zweck beschränken. Die gGmbH Satzung legt zwingend fest, dass Gewinne nicht an Privatpersonen fließen dürfen. Wichtig: Die Satzung muss den Mustersatzungen der Finanzverwaltung entsprechen, um steuerliche Vorteile wie die Körperschaftssteuerfreiheit zu erhalten.
- Optional: Aufnahme von Aufsichtsratsbeschlussmechanismen
- Empfohlen: Einführung von Transparenzbestimmungen für Spendengelder
Regelmäßige Überprüfungen der gGmbH Satzungsgestaltung sind unabdingbar, um Änderungen im Steuerrecht oder im Gemeinnützigkeitsrecht zu berücksichtigen. Die Satzung muss klar die Zweckbindung codieren, sonst droht die Verlust der steuerlichen Privilegien.
Steuerliche Behandlung der gGmbH nach aktuellem Recht 2025
Die Steuerliche Behandlung gGmbH definiert maßgebliche Vorteile für gemeinnützige Unternehmen. Die gGmbH Steuerrecht bietet spezielle Regulierungen, die die Wirtschaftlichkeit der Organisationen stärken. Für 2025 gelten klare Grenzwerte und steuerliche Mechanismen, die eine planbare Finanzierung ermöglichen.
Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer
Die gGmbH Steuern im Bereich Körperschafts- und Gewerbesteuer folgen klaren Regeln: Solange jährliche Einnahmen aus wirtschaftlichen Tätigkeiten unter 45.000 € bleiben, fallen diese Steuern nicht an. Überschreiten sie diesen Freibetrag, entsteht eine Progressive Bemessung. Zulässig sind nur Betriebsaktivitäten, die dem satzungsmäßigen Zweck dienen.
- Freibetrag: 45.000 € jährlich
- Steuerfreistellung gemäß §5 Abs. 1 Nr. 9 KStG und §3 Nr. 6 GewStG
- Überschreitung führt zu Körperschaftssteuer nach §5 Abs. 1 Nr. 9 S. 2 KStG
Umsatzsteuerliche Besonderheiten
Die Umsatzsteuer unterliegt individuellen Regelungen. Dienstleistungen im eigenen Zweckbereich sind steuerfrei, während Produkte unter 7% besteuert werden.
| Leistungstyp | Steuersatz | Bemessungsgrundlage |
|---|---|---|
| Primäre gemeinnützige Leistungen | 0% | §4 Nr. 1 UStG |
| Nebenleistungen (z.B. Merchandise) | 7% ermäßigter Satz | Maximal 35.000 € jährl. (§12 Abs. 2 Nr. 8 UStG) |
| Umwelt- und Bildungsprojekte | Steuerfrei | §4 Nr. 3 UStG |
Spenden und Zuwendungen: steuerliche Aspekte
Zuwendungen an eine gGmbH werden steuerlich abzugsfähig, wenn sie den satzungsmäßigen Zweck unterstützen. Spender erhalten eine 1:1 Abschreibung nach §10b EStG, sofern die gGmbH eine Zuwendungsbestätigung gemäß §63 Abs.5 AO ausstellt.
- Spendenüber 50 € erfordern eine schriftliche Bestätigung
- Maximal 35.000 € jährl. aus Nebentätigkeiten zulässig
- Abweichungen bei Verwendung von Spenden außerhalb des satzungsmäßigen Zwecks führen zu Steuerfolgen
Die Steuerliche Behandlung gGmbH erfordert präzise Einhaltung der Grenzwerte. Regelmäßige Prüfung durch das Finanzamt sorgt für Klarheit. Richtiges Anwenden der gGmbH Steuerrecht sichert langfristige Vorteile.
Geschäftsführung und Governance einer gGmbH
Die Führung einer gGmbH erfordert klare Regeln und ein engmaschiges Governance-System. gGmbH Geschäftsführung müssen stets den gemeinnützigen Zweck der Organisation unterstützen. Gleichzeitig muss der Vorstand transparenzgesteuert arbeiten, um Rechtsanforderungen einzuhalten.
Rechte und Pflichten der Geschäftsführung
Die Geschäftsführer*innen verwalten die gGmbH im Einklang mit der Satzung. Pflichten umfassen:
- Treuepflicht gegenüber der Gemeinnützigkeit
- Regelmäßige Berichterstattung über Finanzen und Projekte
- Vermeidung persönlicher Vorteile
Vergütung in gemeinnützigen GmbHs
Die Vergütung gGmbH muss sachgemäß und nachweisbar begründet sein. Angemessene Gehälter orientieren sich an Branchenvergleichen und berücksichtigen:
- Die Komplexität der Aufgaben
- Die Verantwortung der Position
- Die finanzielle Situation der gGmbH
Überhohe Vergütungen können steuerliche Nachteile wie die Einklassung als verdeckte Gewinnausschüttung nach sich ziehen.
Compliance und Transparenzanforderungen 2025
Die gGmbH Compliance setzt Standards für Risikomanagement und Transparenz. Pflichten 2025 umfassen:
- Jährliche Veröffentlichung von Tätigkeits- und Finanzberichten
- Regelmäßige Prüfung der Gemeinnützigkeitsanforderungen
- Einhaltung der steuerlichen Vorgaben gemäß § 5 KStG und § 3 GewStG
Neue Vorschriften wie das Stiftungsregister ab 2026 erweitern die Transparenzverpflichtungen. Nicht eingehalten zu werden kann zu Strafen oder Verlust der steuerlichen Vorteile führen.
Potenzielle Herausforderungen und Risiken der gGmbH-Rechtsform
Die Wahl der gGmbH als Rechtsform birgt spezifische gGmbH Risiken und gGmbH Nachteile, die Gründern und Leitungen bewusst sein müssen. Herausforderungen gGmbH betreffen insbesondere Finanzierung, Compliance und operative Flexibilität. Ein klares Blick auf diese Punkte hilft, Risiken frühzeitig zu identifizieren.
- Hoher Gründungsaufwand: Notarkosten (800–900 €) und die Einlage von mindestens 12.500 € an Stammkapital steigern die Barforderung. 30% der gGmbHs nennen dies einen entscheidenden gGmbH Nachteil.
- Strenge Finanzamt-Kontrolle: Regelmäßige Prüfungen der Mittelverwendung und das Verbot von Gewinnverteilung an Anteilseigner erfordern sorgfältige Buchführung. 80% der Betriebe nennen dies eine gGmbH Risiken.
- Eng begrenzte Gewinnerlaaubnis: 75% des Gewinns müssen für den gemeinnützigen Zweck verwendet werden. Höhere Verwaltungsaufwendungen können die operative Freiheit einschränken.
„Die Kombination aus hohen Compliance-Kosten und eingeschränkter Gewinnverwendung machen die gGmbH zu einer Herausforderung für Kleinunternehmen.“
Finanzierungsschwierigkeiten sind ein zentrales Problem: 60% der gGmbHs melden Probleme bei Fördermittel-Anerkennung, und 40% hängen stark von Spenden ab. Zudem droht die Rücknahme der Gemeinnützigkeit, wenn Vergütungen der Geschäftsleitung nicht maßgeblich sind. Die Zulassung des Unternehmenszwecks durch das Finanzamt muss frühzeitig geklärt werden, um strukturelle Fehler zu vermeiden. Mit klaren internalen Regelungen und professioneller Steuerberatung lassen sich jedoch viele Herausforderungen gGmbH erfolgreich bewältigen.
Ist die gGmbH die richtige Rechtsform für Ihr Vorhaben in 2025?
Die Wahl der gGmbH Rechtsform wählen ist eine strategische Entscheidung, die langfristige Auswirkungen hat. Für Projekte mit steuerbegünstigtem Zweck, wie sozialer Wirtschaft oder gemeinnütziger Dienstleistung, bietet die gGmbH Vorteile wie Haftungsbeschränkung und steuerliche Vorteile. Doch ist sie für Ihr Vorhaben wirklich geeignet?
Die gGmbH ermöglicht die Kombination von wirtschaftlicher Tätigkeit und gemeinnützigem Ziel. Steuerliche Vorteile wie der Spendenabzug bis 1 Mio. Euro locken, aber Grenzen bestehen: Gewinne dürfen nicht verteilt, sondern nur in den Vermögensstock investiert werden. Für Start-ups mit Umsatzerlösen oder Projekten mit hohem Haftungspotenzial eignet sich die gGmbH Entscheidungshilfe, wenn die Satzung den steuerbegünstigten Zwecken folgt.
Alternativ gibt es die gUG mit 1€ Stammkapital oder den eingetragenen Verein. Doch nur die gGmbH bietet Kapitalhaftung und Markenpräsenz gleichzeitig. Entscheidend sind die Ziele: Macht der gemeinnützige Zweck den Hauptfokus aus? Muss das Projekt Gewinne erzielen, ohne diese an Anteilseigner zu verteilen? Dann ist die gGmbH ein zentrales Instrument.
Die Entscheidung sollte auf gesetzlichen Voraussetzungen basieren, wie der Einhaltung der §60 AO. Beratung durch Rechtsanwälte oder Steuerberater ist ratsam, um die Anforderungen an Satzung, Haftung und Gewinnverwendung korrekt umzusetzen. Die gGmbH bleibt 2025 eine flexible Option, wenn soziale Ziele mit wirtschaftlicher Professionalität verbunden werden.
FAQ
Was sind die Hauptmerkmale einer gGmbH?
Eine gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die hauptsächlich gemeinnützige Zwecke verfolgt und steuerliche Vergünstigungen genießt. Sie bietet Haftungsbeschränkung und ist unternehmerisch strukturiert.
Welche Vorteile hat die gGmbH im Vergleich zur GmbH?
Im Gegensatz zur GmbH, die gewinnorientiert arbeitet, bietet die gGmbH steuerliche Vergünstigungen und ist darauf ausgerichtet, gemeinnützige Ziele zu verfolgen. Zudem kommt es zu einer Haftungsbeschränkung für die Gesellschafter.
Welche steuerlichen Vergünstigungen stehen einer gGmbH zu?
Eine gGmbH ist von der Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und in vielen Fällen von der Umsatzsteuer befreit, sofern sie die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit einhält.
Was sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit?
Für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit müssen die Ziele der gGmbH in der Abgabenordnung verankert sein, und die Aktivitäten müssen selbstlos, ausschließend und unmittelbar gemeinnützig sein.
Wie kann eine gGmbH gegründet werden?
Die Gründung einer gGmbH erfordert die Erstellung eines Gesellschaftsvertrags, die notarielle Beurkundung, die Einzahlung des Stammkapitals sowie die Anmeldung bei der zuständigen Behörde.
Welche Finanzierungsquellen stehen einer gGmbH offen?
gGmbHs können sich durch Spenden, Fördermittel, Zuschüsse, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge, Stiftungsgelder sowie Kredite und Darlehen finanzieren.
Was sollte bei der Satzungsgestaltung für eine gGmbH beachtet werden?
Die Satzung muss Pflichtbestandteile wie den gemeinnützigen Zweck, die Höhe des Stammkapitals und Regelungen zur Gewinnverwendung beinhalten. Ihre Formulierung ist entscheidend für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit.
Welche Herausforderungen kann eine gGmbH im Betrieb begegnen?
Häufige Herausforderungen sind der erhöhte Verwaltungsaufwand, die strengen Nachweispflichten gegenüber dem Finanzamt, sowie die Einschränkung bei der Gewinnverwendung und Kapitalbeschaffung.