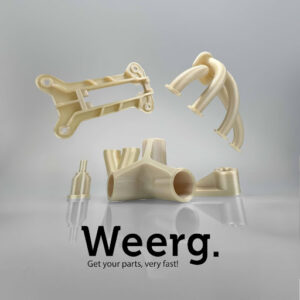Als erfahrener Unternehmer, Innovationsstratege und Autor mit über 15 Jahren Expertise im deutschen Arbeitsrecht möchte ich, Dr. Maximilian Berger, Sie durch dieses komplexe Thema führen. Meine Ratgeber werden regelmäßig von führenden Wirtschaftsmagazinen zitiert und haben tausenden Arbeitnehmern geholfen, ihre Rechte zu verstehen.
Die Freistellung nach Kündigung betrifft jährlich zahlreiche Beschäftigte in Deutschland. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen Sie als Arbeitnehmer Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung nicht mehr erbringen müssen, obwohl das Arbeitsverhältnis formal noch besteht.
Für 2025 haben sich einige wichtige Aspekte in diesem Bereich weiterentwickelt. Der Arbeitgeber muss ausdrücklich erklären, dass er auf Ihre Arbeitsleistung vorübergehend oder endgültig verzichtet. Während dieser Zeit bleiben bestimmte Arbeitnehmerrechte bestehen, während andere möglicherweise ruhen.
In diesem umfassenden Ratgeber erfahren Sie alles über Ihre Ansprüche während der Kündigungsfrist. Wir beleuchten verschiedene Arten der Freistellung, deren rechtliche Grundlagen sowie Ihre Vergütungs- und Urlaubsansprüche. Zudem klären wir, welche Möglichkeiten für Nebentätigkeiten bestehen und welche Pflichten Sie weiterhin erfüllen müssen.
Was bedeutet Freistellung nach Kündigung?
Die arbeitsrechtliche Freistellung nach Kündigung gewinnt 2025 an Komplexität und erfordert ein präzises Verständnis der Rechte und Pflichten. Wenn ein Arbeitsverhältnis endet, stellt sich häufig die Frage, ob der Arbeitnehmer bis zum letzten Arbeitstag erscheinen muss oder freigestellt werden kann. Diese Praxis hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und unterliegt bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen, die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer kennen sollten.
Definition und rechtliche Grundlagen
EineFreistellung nach Kündigungbezeichnet einen Zustand, in dem der Arbeitnehmer von seiner vertraglichen Arbeitspflicht entbunden wird, während das Arbeitsverhältnis formal noch besteht. Der Arbeitgeber verzichtet dabei auf die Arbeitsleistung des Mitarbeiters für den Zeitraum zwischen Kündigung und dem tatsächlichen Ende des Arbeitsverhältnisses.
Die rechtlichen Grundlagen für Freistellungen finden sich nicht explizit im Gesetz, sondern haben sich durch die Rechtsprechung entwickelt. Für 2025 gilt: Eine Freistellung kann auf verschiedenen Wegen zustande kommen:
- Durch eine ausdrückliche Freistellungsklausel im Arbeitsvertrag
- Durch eine Vereinbarung im Aufhebungsvertrag
- Durch einseitige Erklärung des Arbeitgebers (unter bestimmten Voraussetzungen)
- Im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs
Unterschied zwischen bezahlter und unbezahlter Freistellung
Bei derbezahlten Freistellungwird der Arbeitnehmer von seiner Arbeitspflicht befreit, behält jedoch seinen vollen Vergütungsanspruch. Der Arbeitgeber muss weiterhin das vereinbarte Gehalt zahlen, obwohl keine Arbeitsleistung mehr erbracht wird. Diese Form ist in der Praxis am häufigsten anzutreffen und stellt den Regelfall dar.
Im Gegensatz dazu entfällt bei derunbezahlten Freistellungneben der Arbeitspflicht auch der Anspruch auf Vergütung. Diese Konstellation wird oft als „ruhendes Arbeitsverhältnis“ bezeichnet und kommt in der Praxis seltener vor. Für 2025 ist zu beachten: Eine unbezahlte Freistellung kann nur einvernehmlich zwischen beiden Parteien vereinbart werden – eine einseitige Anordnung durch den Arbeitgeber ist nicht möglich.
Die Unterscheidung hat weitreichende Konsequenzen für:
- Die finanzielle Situation des Arbeitnehmers
- Den Sozialversicherungsstatus
- Die Anrechnung von Urlaubsansprüchen
- Die Möglichkeit zur Aufnahme einer Nebentätigkeit
Für Arbeitnehmer ist es daher entscheidend, die Art der Freistellung im Kündigungsschreiben oder in einer separaten Vereinbarung eindeutig festzuhalten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Arten der Freistellung im Überblick
Betrachtet man die Freistellungspraxis im Jahr 2025, lassen sich grundsätzlich mehrere Arten der Freistellung unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Rechtsfolgen nach sich ziehen. Eine wesentliche Unterscheidung besteht zwischen widerruflichen und unwiderruflichen Freistellungen, die für Arbeitnehmer von erheblicher Bedeutung sein können.
Bei einer widerruflichen Freistellung behält sich der Arbeitgeber das Recht vor, den Arbeitnehmer jederzeit zurück an den Arbeitsplatz zu rufen. Diese Form bietet dem Arbeitgeber Flexibilität, falls sich die betriebliche Situation ändert oder ein unerwarteter Personalbedarf entsteht.
Die unwiderrufliche Freistellung hingegen muss vom Arbeitgeber ausdrücklich erklärt werden und ist endgültig. Sie kann die Anrechnung noch offener Urlaubs- und Freizeitausgleichsansprüche beinhalten und schafft für beide Seiten Rechtssicherheit über den weiteren Verlauf bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses.
Freistellung mit Vergütungsanspruch
Die Freistellung mit Vergütungsanspruch stellt den Regelfall dar und bedeutet, dass der Arbeitnehmer trotz Befreiung von der Arbeitspflicht weiterhin sein volles Gehalt erhält. Diese Form basiert auf dem Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ – mit der Ausnahme, dass der Arbeitgeber freiwillig auf die Arbeitsleistung verzichtet.
In der Praxis 2025 umfasst diese Art der Freistellung typischerweise die gesamte Kündigungsfrist. Der Arbeitnehmer behält dabei alle finanziellen Ansprüche wie Grundgehalt, Zulagen und vereinbarte Sonderzahlungen. Auch Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung und Sozialversicherungsschutz bleiben unverändert bestehen.
Besonders vorteilhaft ist diese Variante für Arbeitnehmer, da sie Zeit für die Jobsuche gewinnen, ohne finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen. Arbeitgeber nutzen diese Form häufig, um sensible Unternehmensdaten zu schützen oder ein reibungsloses Ausscheiden zu gewährleisten.
Freistellung ohne Vergütungsanspruch
Die Freistellung ohne Vergütungsanspruch kommt in der Praxis seltener vor und wird oft als „ruhendes Arbeitsverhältnis“ bezeichnet. In diesem Fall wird der Arbeitnehmer von seinen Arbeitspflichten entbunden, erhält jedoch keine Vergütung mehr.
Diese Variante ist 2025 nur unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich zulässig. Sie kann beispielsweise auf einer vertraglichen Vereinbarung basieren oder in speziellen Situationen wie Elternzeit oder Pflegezeit zur Anwendung kommen. Ohne entsprechende Rechtsgrundlage kann der Arbeitgeber eine unbezahlte Freistellung nicht einseitig anordnen.
Während dieser Form der Freistellung ruhen die Hauptpflichten aus dem Arbeitsverhältnis – der Arbeitnehmer muss nicht arbeiten, der Arbeitgeber nicht zahlen. Nebenpflichten wie Loyalitäts- und Verschwiegenheitspflichten bleiben jedoch bestehen. Arbeitnehmer sollten beachten, dass diese Variante Auswirkungen auf ihren Sozialversicherungsschutz haben kann.
Rechtliche Grundlagen der Freistellung nach Kündigung in 2025
Wer die rechtlichen Grundlagen der Freistellung nach Kündigung in 2025 verstehen möchte, muss aktuelle Gesetzesänderungen und neue Urteile berücksichtigen. Die Rechtslage hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und bietet nun einen klareren Rahmen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Besonders wichtig ist dabei die Frage, unter welchen Umständen eine Freistellung rechtmäßig erfolgen kann und welche Rechte beide Parteien haben.
Aktuelle gesetzliche Bestimmungen in Deutschland
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Freistellung sind auch 2025 nicht in einem einzelnen Gesetz zusammengefasst, sondern ergeben sich aus verschiedenen Rechtsquellen. Grundsätzlich gilt weiterhin: Eine Freistellung ist nur dann rechtmäßig, wenn sie entweder vertraglich vereinbart wurde oder besondere Umstände vorliegen.
Seit der Novellierung des Kündigungsschutzgesetzes im Jahr 2024 müssen Freistellungsklauseln in Arbeitsverträgen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Dazu gehört eine klare Regelung zur Vergütung während der Freistellungsphase sowie zur Anrechnung von Urlaubsansprüchen.
Das Bundesarbeitsgericht hat zudem das Recht auf Beschäftigung gestärkt. Eine Freistellung gegen den Willen des Arbeitnehmers ist nur noch in Ausnahmefällen möglich, etwa bei schwerwiegenden Compliance-Verstößen oder wenn die betriebliche Situation dies zwingend erfordert.
| Rechtlicher Aspekt | Bis 2024 | Ab 2025 | Auswirkung für Arbeitnehmer |
|---|---|---|---|
| Freistellungsklauseln | Oft pauschal formuliert | Müssen konkrete Bedingungen nennen | Mehr Rechtssicherheit |
| Vergütungsanspruch | Häufig unklar geregelt | Muss explizit vereinbart sein | Besserer finanzieller Schutz |
| Recht auf Beschäftigung | Schwach ausgeprägt | Deutlich gestärkt | Höhere Hürden für Arbeitgeber |
| Urlaubsanrechnung | Oft zu Lasten des Arbeitnehmers | Klare Regelungen erforderlich | Bessere Planbarkeit |
Relevante Rechtsprechung und neue Urteile
Die Rechtsprechung zur Freistellung hat sich durch mehrere wegweisende Urteile des Bundesarbeitsgerichts (BAG) weiterentwickelt. Besonders bedeutsam ist das Urteil vom März 2024 (Az. 5 AZR 342/23), das die Anforderungen an wirksame Freistellungsklauseln präzisiert hat.
Eine Freistellungsklausel ist nur dann wirksam, wenn sie die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers angemessen berücksichtigt und keine unangemessene Benachteiligung darstellt. Pauschale Freistellungsrechte ohne Einschränkungen sind regelmäßig unwirksam.
Zudem hat das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg im November 2024 entschieden, dass eine Freistellung ohne vertragliche Grundlage nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig ist. Die bloße Befürchtung, ein Arbeitnehmer könnte Betriebsgeheimnisse weitergeben, reicht dafür nicht aus.
Für die Praxis bedeutet dies: Arbeitgeber müssen 2025 deutlich sorgfältiger prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Freistellung gegeben sind. Für Arbeitnehmer bietet die neue Rechtslage mehr Schutz vor willkürlichen Freistellungen und bessere Möglichkeiten, gegen unberechtigte Freistellungen vorzugehen.
Wann ist eine Freistellung nach Kündigung zulässig?
Die Zulässigkeit einer Freistellung nach Kündigung wird durch arbeitsrechtliche Bestimmungen geregelt, die 2025 besondere Beachtung erfordern. Nicht jede vom Arbeitgeber ausgesprochene Freistellung ist automatisch rechtswirksam. Vielmehr müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine zulässige Freistellung vorliegt. Die Rechtslage hat sich in den letzten Jahren zugunsten der Arbeitnehmer entwickelt, was Arbeitgeber bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen.
Voraussetzungen für eine wirksame Freistellung
Die grundlegende Regel im deutschen Arbeitsrecht besagt: Ohne vertragliche Grundlage darf ein Arbeitnehmer nur freigestellt werden, wenn er damit einverstanden ist. Dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Freistellung dar. Ausnahmen von dieser Regel sind nur in besonderen Fällen möglich.
Für eine rechtmäßige Freistellung nach Kündigung müssen 2025 folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Eine wirksame Kündigungserklärung muss vorliegen
- Eine vertragliche Freistellungsklausel existiert im Arbeitsvertrag
- Die Freistellungsklausel erfüllt die verschärften Anforderungen an Präzision und Fairness
- Der Arbeitnehmer stimmt der Freistellung zu (falls keine Klausel vorhanden)
Ohne entsprechende Vertragsklausel kann eine einseitige Freistellung nur in Ausnahmefällen erfolgen. Dazu zählen Situationen, in denen der Arbeitnehmer einer Straftat im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis verdächtigt wird oder wenn eine erhebliche Gefährdung des Betriebsfriedens besteht.
Die Anforderungen an Freistellungsklauseln in Arbeitsverträgen wurden für 2025 verschärft. Arbeitgeber müssen nun präzisere und fairere Bedingungen formulieren, die den Interessen beider Parteien gerecht werden. Pauschale oder zu weit gefasste Klauseln werden von Gerichten häufig als unwirksam eingestuft.
Grenzen des Freistellungsrechts des Arbeitgebers
Das Freistellungsrecht des Arbeitgebers ist nicht unbegrenzt. Es wird durch verschiedene rechtliche Prinzipien eingeschränkt, die den Schutz der Arbeitnehmerinteressen gewährleisten. Die wichtigste Grenze bildet der grundsätzliche Anspruch des Arbeitnehmers auf Beschäftigung.
Folgende Faktoren begrenzen die Arbeitgeberrechte bei der Freistellung:
- Das Recht des Arbeitnehmers auf tatsächliche Beschäftigung
- Der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB)
- Das Verbot der Maßregelung (§ 612a BGB)
- Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
Die Rechtsprechung hat bis 2025 klarere Leitlinien entwickelt, wann eine Interessenabwägung zugunsten des Arbeitgebers ausfallen kann. Bei einer Freistellung muss stets eine Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des Arbeitgebers und dem Beschäftigungsanspruch des Arbeitnehmers erfolgen.
Besonders bei Führungskräften oder Spezialisten, deren berufliche Entwicklung durch eine längere Freistellung beeinträchtigt werden könnte, sind die Hürden für eine einseitige Freistellung höher. Hier müssen Arbeitgeber nachweisen, dass ihre Interessen das Beschäftigungsinteresse des Arbeitnehmers deutlich überwiegen.
Gerichte prüfen bei Streitigkeiten über die Zulässigkeit einer Freistellung immer den Einzelfall und berücksichtigen dabei alle relevanten Umstände. Die bloße Behauptung eines gestörten Vertrauensverhältnisses reicht in der Regel nicht aus, um eine einseitige Freistellung zu rechtfertigen.
Gehaltsanspruch während der Freistellung
Die Regelungen zum Gehaltsanspruch während der Freistellung haben sich für 2025 in einigen Punkten präzisiert. Für Arbeitnehmer ist die finanzielle Sicherheit in dieser Phase besonders wichtig, da sie trotz ausgesprochener Kündigung noch im Arbeitsverhältnis stehen. Die rechtliche Situation hat sich zugunsten der Beschäftigten entwickelt, besonders bei variablen Vergütungsbestandteilen und Sonderzahlungen.
Vergütungspflicht des Arbeitgebers
Bei einer bezahlten Freistellung besteht die Vergütungspflicht des Arbeitgebers grundsätzlich in vollem Umfang weiter. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf sein reguläres Gehalt, als würde er normal weiterarbeiten. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber einseitig die Freistellung erklärt hat.
Besondere Regelungen gelten bei variablen Vergütungsbestandteilen. Bei Stundenlöhnen wird seit 2025 der Durchschnitt der letzten drei Monate vor der Freistellung als Berechnungsgrundlage herangezogen. Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit müssen ebenfalls weitergezahlt werden, wenn diese regelmäßig anfielen.
Entscheidend ist der Annahmeverzug des Arbeitgebers: Er muss die Vergütung zahlen, obwohl er die Arbeitsleistung nicht in Anspruch nimmt. Eine Kürzung des Gehalts während der Freistellung ist nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich.
Sonderzahlungen und Boni während der Freistellung
Auch bei Sonderzahlungen und Boni besteht während der Freistellung grundsätzlich ein Anspruch. Die Rechtsprechung hat bis 2025 klargestellt, dass Weihnachts- und Urlaubsgeld zu zahlen sind, wenn sie im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag vereinbart wurden. Bei leistungsbezogenen Boni ist die Situation differenzierter zu betrachten.
Zielvereinbarungen und daraus resultierende Prämien müssen anteilig bis zum Ende der Beschäftigung berücksichtigt werden. Neu ist seit 2025, dass bei der Berechnung von Zielerreichungsprämien die durchschnittliche Leistung der letzten zwölf Monate als Maßstab gilt, wenn die Zielerreichung durch die Freistellung verhindert wurde.
Provisionen und Umsatzbeteiligungen werden ebenfalls auf Basis der durchschnittlichen Vergütung der letzten Monate berechnet. Der Arbeitgeber darf diese Zahlungen nicht mit der Begründung verweigern, dass während der Freistellung keine neuen Umsätze generiert wurden.
Steuerliche Aspekte der Vergütung in der Freistellungsphase
Die steuerlichen Aspekte der Vergütung während der Freistellung sind für Arbeitnehmer besonders relevant. Grundsätzlich unterliegt das Gehalt während der Freistellung der normalen Einkommensbesteuerung. Es wird wie reguläres Arbeitseinkommen behandelt und ist somit lohnsteuerpflichtig.
Seit 2025 gibt es jedoch Erleichterungen bei der steuerlichen Behandlung von Abfindungen, die im Zusammenhang mit einer Freistellung gezahlt werden. Die Fünftelregelung nach § 34 EStG ermöglicht eine günstigere Besteuerung dieser Einmalzahlungen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die steuerliche Behandlung von Freistellungen im Rahmen von Aufhebungsverträgen. Hier kann eine geschickte Gestaltung zu erheblichen Steuervorteilen führen.
| Vergütungsart | Anspruch während Freistellung | Berechnungsgrundlage | Steuerliche Behandlung |
|---|---|---|---|
| Grundgehalt | Vollständig | Vereinbartes Gehalt | Normale Lohnsteuer |
| Variable Vergütung | Anteilig | Durchschnitt der letzten 3 Monate | Normale Lohnsteuer |
| Sonderzahlungen | Anteilig nach Fälligkeit | Vertraglich vereinbarter Betrag | Normale Lohnsteuer |
| Abfindung | Einmalig | Verhandlungsergebnis | Fünftelregelung möglich |
Urlaubsansprüche bei Freistellung nach Kündigung
Urlaubsansprüche bei einer Freistellung nach Kündigung unterliegen 2025 besonderen rechtlichen Rahmenbedingungen, die sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber kennen sollten. Die Frage, ob bestehende Urlaubstage während der Freistellungsphase abgebaut werden können oder finanziell abgegolten werden müssen, hängt maßgeblich von der Art der ausgesprochenen Freistellung ab. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen widerruflicher und unwiderruflicher Freistellung.
Urlaubsabgeltung vs. Urlaubsgewährung
Bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stehen Arbeitnehmern grundsätzlich zwei Optionen für nicht genommenen Urlaub zur Verfügung: die Urlaubsgewährung während der Freistellung oder die Urlaubsabgeltung in Form einer finanziellen Entschädigung.
Die Rechtsprechung hat bis 2025 eindeutig klargestellt: Bei einer widerruflichen Freistellung darf der Arbeitgeber bestehende Urlaubsansprüche nicht auf die Freistellungszeit anrechnen. Der Grund liegt darin, dass der Arbeitnehmer jederzeit mit einer Rückkehr an den Arbeitsplatz rechnen muss und somit nicht frei über seine Zeit verfügen kann.
Anders verhält es sich bei der unwiderruflichen Freistellung. Hier kann der Arbeitgeber den Resturlaub auf die Freistellungszeit anrechnen, muss dies jedoch ausdrücklich und unmissverständlich erklären. Nach aktueller Rechtslage 2025 ist hierfür eine klare schriftliche Erklärung erforderlich, die dem Arbeitnehmer zugeht.
| Art der Freistellung | Anrechnung von Urlaubsansprüchen | Erforderliche Formalitäten | Rechtliche Grundlage |
|---|---|---|---|
| Widerrufliche Freistellung | Nicht möglich | – | BAG-Rechtsprechung, Stand 2025 |
| Unwiderrufliche Freistellung | Möglich | Ausdrückliche Erklärung des Arbeitgebers | § 7 BUrlG i.V.m. aktueller Rechtsprechung |
| Keine Freistellung | Urlaubsabgeltung in Geld | Automatisch bei nicht genommenem Urlaub | § 7 Abs. 4 BUrlG |
Berechnung des Resturlaubs bei Freistellung
Die korrekte Berechnung des Resturlaubs ist entscheidend für beide Parteien. Zum Stichtag 2025 setzt sich der Gesamtanspruch aus folgenden Komponenten zusammen:

Bei der Berechnung des Resturlaubs müssen zunächst die anteiligen Urlaubsansprüche für das laufende Jahr ermittelt werden. Diese berechnen sich nach der Formel: (Jahresurlaub ÷ 12) × gearbeitete Monate. Hinzu kommen übertragene Urlaubstage aus dem Vorjahr, sofern diese noch nicht verfallen sind.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit 30 Tagen Jahresurlaub, der zum 31. März 2025 gekündigt wird, hat einen anteiligen Anspruch von 7,5 Tagen für das laufende Jahr (30 ÷ 12 × 3). Hat er aus 2024 noch 5 Resturlaubstage, beträgt sein Gesamtanspruch 12,5 Tage.
Besondere Regelungen gelten für Langzeitkranke und Beschäftigte in Elternzeit. Nach der aktuellen Rechtslage 2025 verfallen Urlaubsansprüche für Langzeitkranke nicht automatisch, sondern erst 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres. Bei unwiderruflicher Freistellung kann der Arbeitgeber diese Tage auf die Freistellungszeit anrechnen, muss dies aber explizit erklären.
Nebentätigkeit während der Freistellung
Im Kontext einer Freistellung nach Kündigung eröffnen sich 2025 verschiedene Möglichkeiten für Nebentätigkeiten, die rechtlich genau zu betrachten sind. Viele Arbeitnehmer möchten die Zeit zwischen Kündigung und tatsächlichem Ausscheiden aus dem Unternehmen sinnvoll nutzen. Doch nicht jede Nebentätigkeit ist während der Freistellung erlaubt.
Die Zulässigkeit einer Nebenbeschäftigung hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ihrem Arbeitsvertrag, der Art der Freistellung und nicht zuletzt von der Tätigkeit selbst. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen widerruflicher und unwiderruflicher Freistellung.
Rechtliche Möglichkeiten für Nebentätigkeiten in 2025
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Nebentätigkeiten während der Freistellung haben sich bis 2025 deutlich präzisiert. Bei einer unwiderruflichen Freistellung dürfen Sie grundsätzlich einer anderen Tätigkeit nachgehen, sofern keine vertraglichen Einschränkungen bestehen.
Beachten Sie jedoch, dass Wettbewerbsverbote auch während der Freistellung weiterhin gelten. Eine Tätigkeit bei direkten Konkurrenten Ihres aktuellen Arbeitgebers ist daher meist unzulässig.
Bei widerruflicher Freistellung müssen Sie jederzeit bereit sein, Ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Dies schränkt die Möglichkeiten für Nebentätigkeiten erheblich ein. Hier empfiehlt sich eine schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber.
Anzeigepflicht gegenüber dem Arbeitgeber
Die Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten besteht auch während der Freistellung fort. Nach den 2025 geltenden Regelungen müssen Sie Ihren Arbeitgeber über jede geplante Nebentätigkeit informieren – idealerweise schriftlich.
Folgende Informationen sollten Sie dabei offenlegen:
- Art und Umfang der geplanten Tätigkeit
- Zeitraum der Beschäftigung
- Name des neuen Arbeitgebers
- Voraussichtliche Vergütung
Die Rechtsprechung hat bis 2025 klargestellt, dass der Arbeitgeber die Nebentätigkeit nur aus wichtigem Grund untersagen darf. Ein solcher Grund liegt vor allem bei Wettbewerbstätigkeiten oder bei Überschreitung der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten vor.
Anrechnung von Einkünften aus Nebentätigkeiten
Ob Einkünfte aus Nebentätigkeiten auf Ihre Vergütung während der Freistellung angerechnet werden, hängt von der Art der Freistellung ab. Bei der Anrechnung von Einkünften gelten 2025 folgende Grundsätze:
| Art der Freistellung | Anrechnungsregelung | Besonderheiten | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Einseitige Freistellung | Vollständige Anrechnung möglich | Arbeitgeber kann Anrechnung verlangen | Schriftliche Vereinbarung anstreben |
| Einvernehmliche Freistellung | Abhängig von Vereinbarung | Anrechnungsvorbehalt prüfen | Klare Regelung im Aufhebungsvertrag |
| Unwiderrufliche Freistellung | Meist keine Anrechnung | Ausnahme: vertragliche Regelung | Vertragliche Bestimmungen prüfen |
| Widerrufliche Freistellung | Anrechnung üblich | Arbeitnehmer bleibt zur Arbeitsleistung verpflichtet | Vorab Genehmigung einholen |
Achten Sie besonders auf Anrechnungsvorbehalte in Freistellungsvereinbarungen. Diese regeln, ob und in welchem Umfang anderweitige Einkünfte auf Ihren Vergütungsanspruch angerechnet werden. Ohne ausdrücklichen Vorbehalt ist eine Anrechnung bei einvernehmlicher Freistellung nach aktueller Rechtslage meist nicht zulässig.
Sozialversicherung und Freistellung nach Kündigung
Für den Sozialversicherungsschutz während der Freistellungsphase gelten 2025 besondere Regelungen, die Arbeitnehmer kennen sollten. Obwohl Sie nach einer Kündigung freigestellt sind, bleibt Ihr Arbeitsverhältnis bis zum Ende der Kündigungsfrist formal bestehen. Dies hat entscheidende Auswirkungen auf Ihren Sozialversicherungsstatus. Grundsätzlich ändert sich sozialversicherungsrechtlich durch die Freistellung nichts – alle Ansprüche bleiben in der Regel erhalten.
Krankenversicherungsschutz während der Freistellung
Bei einer bezahlten Freistellung bleibt Ihr Krankenversicherungsschutz vollständig bestehen. Der Arbeitgeber ist weiterhin verpflichtet, die entsprechenden Beiträge abzuführen. Dies gilt für die gesetzliche wie auch für die private Krankenversicherung.
Werden Sie während der Freistellungsphase krank, haben Sie 2025 weiterhin Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach den üblichen gesetzlichen Regelungen. Die Meldepflicht gegenüber dem Arbeitgeber besteht fort – Sie müssen Ihre Arbeitsunfähigkeit also wie gewohnt anzeigen und nachweisen.
Bei unbezahlter Freistellung hingegen müssen Sie sich um Ihren Versicherungsschutz selbst kümmern. Hier besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung oder Sie müssen die Beiträge für Ihre private Krankenversicherung vollständig selbst tragen.
Auswirkungen auf Renten- und Arbeitslosenversicherung
Während einer bezahlten Freistellung werden weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung abgeführt. Dadurch entstehen Ihnen keine Nachteile bei Ihren späteren Rentenansprüchen. Die Beitragszahlungen erfolgen auf Basis des regulären Arbeitsentgelts, das Sie während der Freistellung erhalten.
Für die Arbeitslosenversicherung gilt: Die Freistellungszeit unterbricht nicht die für den Anspruch auf Arbeitslosengeld wichtige Anwartschaftszeit. Nach den 2025 geltenden Regelungen sollten Sie sich jedoch spätestens drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden, um keine Nachteile zu riskieren.
| Versicherungsart | Bezahlte Freistellung | Unbezahlte Freistellung | Besonderheiten 2025 |
|---|---|---|---|
| Krankenversicherung | Vollständiger Schutz | Freiwillige Weiterversicherung nötig | Digitale Krankmeldung auch bei Freistellung |
| Rentenversicherung | Beitragszahlung wie bisher | Keine Beitragszahlung | Anrechnung auf Rentenpunkte unverändert |
| Arbeitslosenversicherung | Anwartschaftszeit läuft weiter | Anwartschaftszeit läuft weiter | Meldepflicht 3 Monate vor Vertragsende |
| Pflegeversicherung | Vollständiger Schutz | Freiwillige Weiterversicherung nötig | Neue Beitragssätze seit Januar 2025 |
Pflichten des Arbeitnehmers während der Freistellung
Die Freistellung von der Arbeit bedeutet nicht das Ende aller arbeitsvertraglichen Verpflichtungen – im Gegenteil, bestimmte Pflichten bleiben für Arbeitnehmer auch 2025 bestehen. Obwohl Sie nicht mehr aktiv arbeiten müssen, sind Sie rechtlich weiterhin an verschiedene Arbeitnehmerpflichten gebunden. Diese Verpflichtungen schützen die Interessen des Unternehmens auch während der Übergangsphase bis zur endgültigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Verschwiegenheitspflicht und Loyalitätspflichten
Die Verschwiegenheitspflicht bleibt auch während der Freistellung vollständig bestehen. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder interne Daten an Dritte weitergeben. Dies gilt insbesondere für sensible Unternehmensinformationen wie:
- Kundendaten und Vertragsdetails
- Interne Prozesse und Know-how
- Finanzielle Informationen des Unternehmens
- Produktentwicklungen und Innovationen
Die Rechtsprechung hat bis 2025 die Anforderungen an die Loyalitätspflichten während der Freistellung präzisiert. Sie dürfen sich nicht geschäftsschädigend verhalten oder den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen. Negative Äußerungen in sozialen Medien oder gegenüber Kunden können rechtliche Konsequenzen haben und sogar zu Schadensersatzansprüchen führen.
Beachten Sie, dass diese Pflichten nicht mit dem letzten Arbeitstag enden. Die Verschwiegenheitspflicht gilt in vielen Fällen zeitlich unbegrenzt fort, während andere Loyalitätspflichten zumindest bis zum formellen Ende des Arbeitsverhältnisses bestehen bleiben.
Herausgabe von Arbeitsmitteln und Unterlagen
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeitnehmerpflichten betrifft die Herausgabe von Arbeitsmitteln und Unterlagen. Die Regelungen haben sich bis 2025 weiterentwickelt und unterscheiden nun klarer zwischen verschiedenen Nutzungsarten.
Bei Diensthandys und Laptops kommt es zunächst darauf an, ob eine private Nutzung dieser Geräte vertraglich gestattet ist. Ist dies der Fall, hängt die Pflicht zur sofortigen Rückgabe von weiteren Umständen ab. Ähnlich wie bei Dienstwagen können spezifische Regelungen im Arbeitsvertrag enthalten sein, die dem Arbeitgeber das Recht einräumen, die Geräte auch während der Freistellung zurückzufordern.
| Arbeitsmittel | Rückgabepflicht bei reiner Dienstnutzung | Rückgabepflicht bei erlaubter Privatnutzung | Besonderheiten 2025 |
|---|---|---|---|
| Dienstlaptop | Sofort bei Freistellung | Je nach Vereinbarung, oft erst zum Vertragsende | Datensicherung durch Arbeitgeber vorgeschrieben |
| Diensthandy | Sofort bei Freistellung | Oft Übernahme-Option zum Zeitwert möglich | Recht auf digitale Kontaktdaten-Mitnahme |
| Zugangskarten/Schlüssel | Sofort bei Freistellung | Nicht relevant | Digitale Zugangsrechte werden automatisch deaktiviert |
| Unterlagen/Dokumente | Sofort bei Freistellung | Nicht relevant | Auch digitale Kopien müssen gelöscht werden |
Die Verweigerung der Herausgabe kann rechtliche Konsequenzen haben, darunter Schadensersatzforderungen oder sogar eine fristlose Kündigung. Achten Sie daher auf eine vollständige und dokumentierte Rückgabe aller Arbeitsmittel gemäß den Vorgaben Ihres Arbeitgebers.
Rechtsschutz bei unrechtmäßiger Freistellung
Wenn Arbeitgeber eine Freistellung ohne ausreichende rechtliche Grundlage aussprechen, stehen Arbeitnehmern in 2025 wirksame Schutzmechanismen zur Verfügung. Der Rechtsschutz bei Freistellung hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene Grundsatzurteile deutlich verbessert. Betroffene sollten ihre Rechte kennen und wissen, wie sie bei einer unrechtmäßigen Freistellung vorgehen können.
Die Rechtsprechung hat die Anforderungen an Arbeitgeber erhöht und die Kriterien für rechtmäßige Freistellungen präzisiert. Dadurch genießen Arbeitnehmer heute einen umfassenderen Schutz vor willkürlichen Freistellungen als noch vor einigen Jahren.
Wann ist eine Freistellung rechtswidrig?
Eine rechtswidrige Freistellung liegt vor, wenn der Arbeitgeber das grundsätzliche Recht des Arbeitnehmers auf Beschäftigung verletzt. Dies kann in verschiedenen Situationen der Fall sein. Besonders problematisch sind Freistellungen, für die keine ausreichenden sachlichen Gründe vorliegen.
Auch wenn die Freistellung gegen vertragliche Vereinbarungen verstößt, ist sie als unrechtmäßig anzusehen. Dies gilt ebenso, wenn die Maßnahme diskriminierenden Charakter hat oder als Reaktion auf die rechtmäßige Ausübung von Arbeitnehmerrechten erfolgt.
Die Gerichte haben bis 2025 weitere Kriterien entwickelt, die eine unrechtmäßige Freistellung kennzeichnen:
- Fehlende oder unzureichende Begründung durch den Arbeitgeber
- Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme im Vergleich zum angegebenen Grund
- Missachtung von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats
- Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz im Betrieb
Handlungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer
Betroffene Arbeitnehmer haben verschiedene Handlungsmöglichkeiten, um sich gegen eine unrechtmäßige Freistellung zu wehren. An erster Stelle steht die Geltendmachung des Beschäftigungsanspruchs durch eine Klage vor dem Arbeitsgericht oder eine einstweilige Verfügung.
Bei besonderer Dringlichkeit kann eine einstweilige Verfügung innerhalb weniger Tage erwirkt werden. Dies ist besonders relevant, wenn die Freistellung erhebliche berufliche Nachteile mit sich bringt, etwa den Verlust wichtiger Qualifikationen oder Kontakte.
Darüber hinaus können Arbeitnehmer folgende Ansprüche prüfen:
- Schadensersatzansprüche, wenn durch die Freistellung ein konkreter Vermögensschaden entstanden ist
- Bei bezahlter Freistellung: Weiterbeschäftigung trotz Freistellung einklagen
- Bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen: Schmerzensgeldansprüche
Für eine erfolgreiche Durchsetzung dieser Ansprüche ist eine frühzeitige rechtliche Beratung entscheidend. Die Erfolgsaussichten haben sich bis 2025 durch verschiedene höchstrichterliche Entscheidungen verbessert, die das Recht auf tatsächliche Beschäftigung gestärkt haben.
Fazit: Ihre Rechte und Pflichten bei der Freistellung nach Kündigung
Die Freistellung nach Kündigung bleibt auch 2025 ein wichtiges Instrument im Trennungsprozess zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wie wir gesehen haben, existiert kein gesetzlicher Anspruch auf Freistellung für Arbeitnehmer – sie kann entweder einvernehmlich vereinbart oder vom Arbeitgeber aus sachlichen Gründen angeordnet werden.
Bei der bezahlten Freistellung behalten Sie Ihren vollen Vergütungsanspruch. Achten Sie besonders auf die korrekte Abgeltung von Resturlaub und die Fortzahlung von Sonderzahlungen. Die unbezahlte Freistellung hingegen sollten Sie kritisch prüfen, da hier Ihre finanziellen Rechte erheblich eingeschränkt werden können.
Ihre Pflichten während der Freistellung bleiben bestehen: Verschwiegenheit über Betriebsgeheimnisse, Loyalität zum Arbeitgeber und die Rückgabe von Firmeneigentum. Bei Nebentätigkeiten während der Freistellungsphase ist 2025 besondere Vorsicht geboten – prüfen Sie Ihren Arbeitsvertrag und die Freistellungsvereinbarung auf entsprechende Klauseln.
Für eine rechtssichere Freistellung nach Kündigung empfehlen wir:
1. Lassen Sie die Freistellungserklärung schriftlich festhalten
2. Klären Sie offene Fragen zu Vergütung und Urlaubsansprüchen
3. Prüfen Sie Ihre Sozialversicherungssituation während der Freistellung
4. Holen Sie bei Unklarheiten rechtzeitig rechtlichen Rat ein
Die Rechtslage zur Freistellung entwickelt sich stetig weiter. Aktuelle Urteile stärken tendenziell die Position der Arbeitnehmer. Eine faire Gestaltung des Trennungsprozesses liegt letztlich im Interesse beider Parteien.